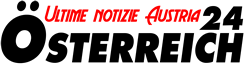Als der damalige Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Herbst 2023 sein letztes Budget vorlegte, plante er im Bund einen Abgang von 20,7 Milliarden Euro ein. Realisiert wurde ein Minus von 19,1 Milliarden Euro, was zwar immer noch sehr schlecht ist, aber ein bisschen besser als erwartet war. Trotzdem kletterte das Defizit von 2,7 auf 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinauf.
Die erhebliche Zielverfehlung hatte zwei Ursachen. Erstens schrumpfte das BIP real und lag nur bei 482 Milliarden Euro (statt wie erwartet bei 505 Milliarden). Damit verschlechterte sich die Basis für die Berechnung des Defizits. Zweitens lieferten die Länder und Gemeinden, anders als gedacht, keine positiven Beiträge, sondern ein sattes Defizit von 4,6 Milliarden oder einem ganzen Prozentpunkt des BIP. So schnell wird sich das auch nicht ändern, ein Überschuss ist nicht in Sicht.
In einem ersten Schritt hat die Regierung im Zuge ihrer Budgetvorlage an zwei Schrauben gedreht, die zumindest etwas Linderung bringen sollten. Zum einen werden die Ertragsanteile für Länder und Gemeinden angehoben, zum anderen wird aus dem Kommunalen Investitionspaket, kurz KIP genannt, ein unbürokratisches Finanzzuweisungspaket. „Es ist ein Vertrauensbeweis der Bundesregierung gegenüber den Gemeinden“, sagte ÖVP-Abgeordneter Manfred Hofinger in der Budgetdebatte am Mittwoch.
Manfred Hofinger, ÖVP-Abgeordneter und Bürgermeister von Lambrechten.
Hofinger sitzt nicht nur im Nationalrat, sondern steht auch Lambrechten im Innviertel als Bürgermeister vor. Er berichtet der Kleinen Zeitung, dass die Personalkosten in seiner Gemeinde in den letzten Jahren um 27 Prozent gestiegen, die Einnahmen aber stagniert seien. Letzteres ist eine Folge der Abschaffung der kalten Progression sowie der anhaltenden Rezession. Von den gesamten Steuereinnahmen erhalten die Gemeinden aus dem Finanzausgleich zwölf Prozent. Seit Ewigkeiten. Die Zahl der Aufgaben und damit der Ausgaben ist aber gewachsen, das betrifft die Kinderbetreuung und den Bereich Gesundheit und Pflege. Bereits im Jahr 2017 hat der Bund sein erstes Subventionspaket geschnürt und den Gemeinden Zuschüsse für Investitionen gewährt. Es war eine außertourliche Förderung.
Keine Klimaschwerpunkte mehr
Während der Covid-Pandemie griff der Bund erneut auf dieses Instrument zurück. Mittlerweile ist das dritte Investitionspaket in Kraft, in dem noch rund 830 Millionen Euro liegen. Im Laufe der Zeit ist die notwendige Co-Finanzierung herabgesetzt worden, von anfangs 50 Prozent auf zuletzt nur mehr 20 Prozent. Doch selbst diesen Anteil konnten nicht so wenige Gemeinden nicht mehr aufbringen. Nun fällt die Co-Finanzierung komplett.
Aus den Investitionsförderungen werden nun einfache Zuweisungen, die zudem unbürokratisch in drei Tranchen an die Gemeinden überwiesen werden. Das bietet eine zweifache Entlastung, da sich die Gemeindemitarbeiter nicht mehr mit den teils mühsamen Anträgen herumplagen müssen. Auf der anderen Seite wurden bei vergangenen Hilfspaketen Klimaschwerpunkte gesetzt, die Hälfte des Fördertopfes war für Projekte zur Energiewende gewidmet. Diese Steuerung fällt nun komplett weg.
Ertragsanteile steigen wieder
Vermutlich noch wichtiger für die Bürgermeister ist die Entwicklung bei den Ertragsanteilen, die nach drei Jahren wieder steigen. Zumindest laut Budget sollen bis 2029 im Durchschnitt jährlich fast vier Prozent mehr Ertragsanteile an die Gemeinden gehen. Das ist eine Folge, dass die Konsolidierung nicht nur ausgabenseitig erfolgt, sondern auch durch höhere Steuereinnahmen und etwa ein Teil der kalten Progression doch wieder einbehalten wird. Die kalte Progression soll aber nur temporär ein Comeback geben. Das ist zumindest der Plan. Sollte sie nach 2029 wieder zur Gänze abgegolten werden, würden die Gemeinden wieder vor dem Problem stehen, dass sie zwar die Inflation zur Gänze tragen müssen, aber die Ertragsanteile nicht mit der Teuerung mitwachsen. „Es werden Strukturreformen notwendig sein“, sagt Hofinger. Das betrifft die Gemeinden auch selbst, wie er betont, etwa durch mehr kommunale Kooperationen. Aber es betrifft auch den Finanzausgleich. Der nächste (ab 2029) wird eine große Reform beinhalten müssen – im Vergleich zum jetzigen Erste-Hilfe-Paket wird das die schwierigere Übung.