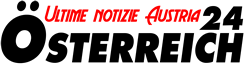Effektive Maßnahmen zur Bekämpfung des Islamismus: Der Schlüssel zum Erfolg
Vor zehn Jahren wurde erstmals im Parlament über das „Verbot des politischen Islams“ diskutiert. Der Antrag des Team Stronachs fand damals keine Mehrheit, aber ähnliche Vorstöße kamen in den folgenden Jahren von der FPÖ, der ÖVP und sogar von Teilen der SPÖ – nun erneut nach dem Anschlag in Villach. Die Kärntner ÖVP und die burgenländische SPÖ haben sich öffentlich für ein gesetzliches Verbot des politischen Islams ausgesprochen.
Warum bisher nur politische Forderungen existieren, hat zwei Hauptgründe: Erstens ist der Begriff nicht klar definiert und die Grenzen zur tiefen Religiosität sind fließend. Zweitens steht das strafrechtliche Verbot einer Gesinnung im Konflikt mit der Meinungs- und Religionsfreiheit. Trotzdem hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um sich gegen islamistische Strömungen zu wehren. Es besteht jedoch noch eine große Lücke.
Der politische Islam als Herrschaftsideologie richtet sich nicht nur gegen westliche Gesellschaften, sondern auch gegen den Kampf um die Deutungshoheit innerhalb der Religion. Mit dem Islamgesetz von 2015 wurde ein Verbot der Auslandsfinanzierung von Moscheen eingeführt, das diesen spezifischen Bereich des politischen Islams anspricht. Zuvor wurden zahlreiche Imame von staatlichen Verbänden im Ausland finanziert. Das Symbole-Gesetz wurde ebenfalls beschlossen, um die Verbreitung von Symbolen islamistischer und rechtsextremer Gruppierungen zu unterbinden. Es wurde seitdem dreimal ergänzt, aber eine Aktualisierung ist unumgänglich.
### Aufregung um Kalifat-Demonstrationen
Eine Gruppe, deren Symbole verboten sind, ist die Hizb ut-Tahrir, die in den 1950ern als Ableger der Muslimbruderschaft gegründet wurde und ein Kalifat anstrebt. In Deutschland unterliegt sie einem Betätigungsverbot seit 2003, aber in Österreich kann sie weiterhin aktiv sein, solange sie auf ihre Symbole verzichtet. Im letzten Jahr sorgten zwei islamistische Demonstrationen in Hamburg für Aufsehen, zu denen die Plattform „Muslim Interaktiv“ aufgerufen hatte. Dabei wurde offen ein Kalifat gefordert. Diese und ähnliche Netzwerke missionieren über Social-Media-Plattformen wie Youtube, Tiktok und Instagram und haben zigtausende Follower. Sie werden der verbotenen Hizb ut-Tahrir zugerechnet.
Nach dem Terroranschlag in Wien wurde der Straftatbestand der „religiös motivierten extremistischen Verbindung“ (§247a) eingeführt, um den rechtlichen Graubereich vor dem Terrorismus zu abdecken. Trotzdem gab es keine einzige Verurteilung und nur vier Anzeigen nach diesem Paragraphen, da es schwierig ist, Verbindungen zu bestrafen, die die demokratische Grundordnung ersetzen wollen. Der Verfassungsrechtler Peter Bußjäger sieht das Vereinsgesetz als möglichen Hebel, um gegen extremistische Strömungen vorzugehen. In Deutschland können Vereine verboten werden, die gegen die „verfassungsmäßige Ordnung“ und den „Gedanken der Völkerverständigung“ agieren, während es in Österreich keine vergleichbaren Verbotsgründe gibt.
Eine mögliche Schließung der Lücke im Kampf gegen islamistische Strömungen könnte durch Änderungen im Vereinsgesetz erreicht werden. Salafistische Praktiken könnten dadurch nicht direkt verboten werden, aber es würde die Bildung von Zusammenschlüssen und Finanzierungen erschweren. Personen, die nach der Auflösung eines Vereins weiterhin Vereinstätigkeiten ausführen, könnten mit Geldstrafen belegt werden. Derzeit ist die Strafe von 726 Euro im Wiederholungsfall relativ gering, aber sie könnte erhöht werden. Eine einfache Mehrheit im Gesetzgeber wäre für eine Gesetzesänderung erforderlich.